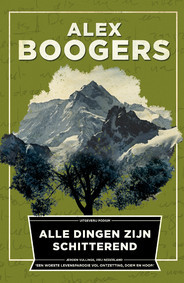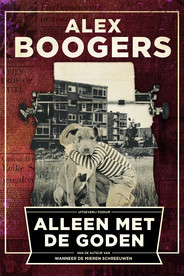Von Hannah Zirkler

Ein Aufzug bringt mich in den siebten Stock der Amsterdamer Stadtbibliothek. Dort an einem Tisch nahe dem Fester warte ich auf den Autor Alex Boogers und blicke aus dem Fenster über die Stadt. Bei meiner Recherche über ihn habe ich schon einige Pressefotos gesehen, trotzdem war ich von seiner Erscheinung ziemlich beeindruckt. Er tritt aus dem Aufzug, streng nach hinten gekämmte graue Haare, schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze schlanke Krawatte. Seine eisblauen Augen blicken sich suchend um und ich, unweigerlich an James Bond erinnert, winke ihm zu. Er setzt sich und wir bestellen Kaffee. Wir reden über das Wetter, Paris und unser Vorhaben hier in Amsterdam, dann beginnen wir das Interview.

Wie bist du Autor geworden?
(lacht) Allein mit dieser Geschichte könnten wir hier jetzt eine ganze Weile sitzen. Aber ich mache es kurz. Ich bin kein typischer Autor, der schon als Kind davon geträumt hat zu schreiben. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie und Literatur spielte bei uns keine große Rolle. Auch mir waren Bücher damals total egal. Ich wollte draußen mit meinen Freunden abhängen, Fußball spielen, einfach Spass haben. Unsere Gegend war alles andere als behütet, dort konnte man nur überleben indem man zeigte wer man ist und was man kann. Das bedeute auch schon mal, dass man die Fäuste einsetzten musste. Aber ich hatte immer diese seltsamen Bilder im Kopf kurz vorm Schlafengehen. Wie wenn man nach einem Kinobesuch vom Film erzählen will. Man erzählt nur die Highlights und beschreibt die Szenen, die sich als Bilder im Kopf festgesetzt haben. Und solche Bilder waren das bei mir, nur dass ich vorher keinen Film gesehen hatte. Ich konnte nie wirklich beschreiben, was das war, aber ich musste es aufschreiben, um die Bilder aus meinem Kopf zu bekommen. Und so schrieb ich auf, was ich in meinem Kopf sah. Ergebnis waren aber keine richtigen Geschichten, eher wirre Gedichte, die ich manisch aufschrieb, nie weiter beachtete und unter meinem Bett versteckte.
Du hast also nie jemandem davon erzählt?
Nein. Dort wo ich aufgewachsen bin, erzählt man nicht mal eben so, dass man letzte Nacht ein Gedicht geschrieben hat. Die hätten mich alle für verrückt gehalten. Um ein Autor zu werden, sollte man eigentlich in einem Umfeld leben, dass einem sagt „Hey du kannst das. Du bist gut, mach was draus.“ Aber Menschen wie ich, wir schreiben eigentlich nicht. Was auch nicht wirklich hilfreich war: Mit 15 habe ich erfahren, dass der Vater, mit dem ich mein ganzes Leben verbracht habe, nicht mein richtiger Vater ist. Ich habe also in meiner eigenen Truman-Show gelebt. Meine Eltern ließen sich dann scheiden und ich verbrachte viel Zeit mit meinen Freuden. Ich war ein sehr wildes Kind.
Wenn ich mich jetzt mit anderen Autoren unterhalte, fühle ich mich immer noch wie damals. Wie der kleine verwirrte Junge aus dieser kaputten Gegend, der es einfach nicht verstehen kann. Schreiben fühlt sich für mich nicht wie eine Errungenschaft an, eher wie eine Verstümmelung meines Verstands. Ich fühle mich immer etwas anders, danebenstehend. Und alle können mir noch so oft sagen „Du bist ein guter Autor, deine Bücher sind toll“, das reicht nie aus.
Und wie kam es dann dazu, dass du richtig mit dem Schreiben begonnen hast?
Mit 16 hatte ich zusammen mit einem Freund einen Moped-Unfall. Wir fuhren mit einer Zündapp auf einer dunklen Straße, mein Freund übersah, dass vor uns die Straße aufgerissen war und wir rasten in einen Berg aus Pflastersteinen. Dabei brach ich mir den Rücken. Seche Wochen verbrachte ich im Krankenhaus und musste dort mühsam lernen, wieder zu gehen, zu stehen und zu sitzen. Mein gesamter Oberkörper war eingegipst und ich konnte zuerst nur auf dem Bauch liegen. Nach einer Weile drehte ich ziemlich durch und eine Krankenschwester brachte mir eine alte Schreibmaschine. So konnte ich auf dem Bauch liegend meine ersten Sätze auf einer Schreibmaschine schreiben. Es dauerte insgesamt ein Jahr, bis der Rücken vollständig geheilt war, aber ich habe bis heute Schmerzen.
Das muss eine sehr harte Zeit gewesen sein.
Ja, das war es. Seitdem ich acht Jahre alt war, träumte ich von einer Karriere als Kickboxer, die war nun erst einmal vorbei, ich konnte ja nicht mal für eine längere Zeit stehen. Für mich gab es schon immer zwei Wege. Der eine zum Boxen und der andere zum Schreiben. Obwohl ich davon und den Bildern in meinem Kopf eigentlich am liebsten nichts wissen wollte. Eines Tages fiel mir dann eine Literaturzeitschrift in die Hände, und da wurde mir bewusst, dass man da tatsächlich veröffentlicht werden kann, wenn man etwas einreicht. Ich fing also an, meine Gedichte an Literaturmagazine zu schicken, und als das erste veröffentlicht wurde, fühlte ich mich wie ein richtiger Schriftsteller. Natürlich bekam ich dafür kein Geld, aber einen Büchergutschein und da dachte ich, wow, jetzt bin ich ein Autor (lacht). Damals war ich 19. Ich habe irgendwann akzeptiert, dass ich schreiben will, dass das etwas ist, das mich ausmacht und das ich weiter verfolgen möchte.
Hast du von da an dann nur geschrieben?
Nein, ich habe mein Abi nachgeholt und Philosophie und Recht studiert, aber nie abgeschlossen. Ich bin auch jetzt kein hauptberuflicher Autor. Das könnte ich mir nicht leisten. Nebenbei arbeite ich als Kickboxing-Lehrer. Das ist ein toller Ausgleich für mich. Aber um ehrlich zu sein, als ich damals mein erstes Buch veröffentlichte, dachte ich, nun bin ich Autor und verdiene mein Geld damit. So kenne ich es aus meiner Kindheit. Wenn du Arbeit hast, verdienst du damit auch Geld. Das habe ich dann auch auf den Beruf eines Autors übertragen. Aber das reicht natürlich nicht aus, um eine Familie zu ernähren. Das war ein wirklicher Eye-opener für mich.

Wie kam es dann dazu, dass dein erstes Buch veröffentlicht wurde?
Mein erstes Romanmanuskript schickte ich an Podium. Damals war ich 27 Jahre alt. Veröffentlicht wurde der Roman dann zwei Jahre später. Das hat sich etwas hinausgezögert, denn ich wollte anonym bleiben. Auch dem Verleger Joost Nijsen gegenüber. Ich schrieb ihm einen Brief unter dem Namen M.L. Lee, in dem stand, dass ich ein Mädchen von der Straße bin und ich ihm meine Geschichte nicht schicken werde. Daraufhin begann ein Briefwechsel zwischen Joost und mir. Er meinte damals, der Brief klinge vielversprechend und er würde gerne die Geschichte hören. Ich antwortete ihm, dass ich nicht an diese falsche Verlags- und Autorenwelt glaube und dass ich intellektuelle Menschen nicht mag. Ich war damals sehr jung und hatte diese starken Rückenschmerzen, also erfand ich einfach einen Charakter. Sie sah aus wie ich, nur war sie ein junges Mädchen. Und Joost war einverstanden, ich sollte ihm den Text nicht schicken, aber er glaubte, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Daraufhin schickte ich ihm dann das Manuskript. Das las er dann und wollte es sofort veröffentlichen. Ich stimmte zu, nur wollte ich immer noch anonym bleiben. Er stimmte zu, auch wenn er meinte, wenn wir es so machen, kann ich keine Aufmerksamkeit erwarten. Doch in seinen Augen war die Geschichte so wichtig und in sich fertig, dass er sie dennoch veröffentlichen wollte. Mir war diese ganze Publicity auch nie wichtig. Ich will für mich schreiben und nicht für andere. Kunst sollte nie für jemanden anderen entstehen, nur für einen selbst. Und wenn das Endergebnis dann jemand mag, dann ist das gut, aber es sollte nicht die Intention sein, das eigene Ego zu stärken. Als das Buch dann auf dem Weg in die Druckerei war, meinte Joost, dass es doch nun nicht Zeit wäre, sich persönlich zu treffen. Ich war ziemlich nervös, weil Joost ja ein junges Mädchen erwartete. Als wir uns dann das erste Mal gegenüberstanden standen, war das erste was Joost sagte: „Ich bin froh, dass du kein alter, verbitterte Journalist um die 50 bist, der nun versucht mit einem Roman bekannt zu werden.“ Wir lachten und ich erzählte ihm meine Geschichte, die fand er idealistisch, romantisch und immer noch sehr vielversprechend.
Hast du dann tatsächlich nur wenig Aufmerksamkeit für dein Debüt bekommen?
Ja, es wurde nicht groß besprochen von den gängigen Medien. Und das war in Ordnung so. Aber die wenigen Besprechungen waren sehr gut.
Wann und warum hast du dann beschlossen, doch unter deinem richtigen Namen zu veröffentlichen?
Irgendwann überzeugte mich Joost dann, dass es gut wäre, unter meinen Namen zu veröffentlichen. Er erklärte mir einiges über den Literaturbetrieb und war der Meinung, dass ich ein zu großes Talent wäre, um nicht unter meinem richten Namen zu veröffentlichen. Und so verwendete ich ab meinem zweiten Buch meinen Namen und bekam tatsächlich auch mehr mediale Aufmerksamkeit.

Vor einigen Wochen hast du ein Pamphlet veröffentlicht mit dem Titel „Der Leser ist nicht tot“. Worum geht es darin und was war deine Intention dafür?
Verlage, Autoren und Buchhändler beschweren sich immer darüber, dass zu wenig Bücher gekauft werden, dass immer weniger Menschen lesen. Und das stimmt, aber was ich nicht verstehe ist, warum keine Leser mehr „gemacht“ werden. Es gibt doch immer noch die gleiche Gruppe Leser, die ist doch nicht von einer neuen Generation Leser ersetzt worden. Unsere digitale Umwelt kann nicht der Grund dafür sein, dass Menschen weniger lesen.
Meiner Meinung nach beginnt es in der Schule. In der Grundschule wird noch viel Zeit dafür verwendet, Geschichten vorzulesen, Kinder zu ermuntern, eigene Geschichten zu erzählen. Aber ab der weiterführenden Schule bleibt dafür keine Zeit mehr. Die Kinder stehen unter Leistungsdruck, da bleibt keine Zeit für eine Geschichte, für Literatur. Es gibt zwar eine Leseliste, aber selbst für das Lesen dieser Bücher wird sich kaum Zeit genommen. Die Schüler werden nicht ermutigt, die Bücher zu lesen. Viele informieren sich nur im Internet darüber oder schauen sich den Film dazu an, liefern ihren Leistungsnachweis und damit hat es sich. Auf diesen Leselisten findet sich auch keinerlei aktuelle Literatur. Klar, zu älteren Büchern haben die Lehrer bereits ihr Material, das spart Zeit. Aber das ermuntert doch die Schüler nicht, über die Liste hinaus Bücher zu lesen, ihren eigenen Geschmack zu entwickeln und kreativ zu sein. Alles wird ihnen vorgefertigt präsentiert, sie müssen sich nichts mehr ausdenken, nichts selbständig kreieren. Kinder sollen einfach ihre Noten und Leistungen abliefern, mehr nicht.
Ich bin mir durchaus bewusst, dass die Lehrer diesen Zustand nicht wirklich ändern können, die stehen ebenfalls unter großem Druck. Hier muss auf politischer Ebene gehandelt werden. Denn nur, wenn Kindern Bücher näher gebracht werden und Bücher für sie zu einem wichtigen Teil ihres Leben werden, haben wir auch wieder mehr Leser. Und natürlich auch mehr Schriftsteller. Denn ich bin überzeugt, dass es nicht weniger junge Menschen gibt, die schreiben können, sondern sie werden nur weniger dazu ermutigt und darin unterstützt, es zu tun. Wenn es einem Menschen an Inspiration fehlt, an Kreativität, dann ist er auch nicht fähig, Sympathie für andere zu entwickeln und kann keine fremden Kulturen verstehen. Das führt dazu, dass jeder nur noch für sich existiert. Wir leben alle alleine in unserer eigenen Welt. Dies alles wird sich erst in ein paar Generationen bemerkbar machen, aber dann wird sich wieder Kulturellem zugewendet, da bin ich mir sicher, um die Fantasie zu fördern. Gerade glauben wir, alles was wir brauchen, liegt in der technischen Revolution. Ich bin der Meinung, dass wir aber auch Literatur und Geschichten brauchen und immer brauchen werden. Geschichten halten uns zusammen, aber das sehen viele einfach nicht.
Geht es in dem Pamphlet auch um Autoren?
Ja. Autoren heutzutage wollen Erfolg haben mit ihren Geschichten und deshalb schreiben sie. Sie wollen ein großer Schriftsteller sein. Sie sind so damit beschäftigt, ein Autor zu sein, dass sie gar nicht darüber nachdenken, was es bedeutet, eine Geschichte zu haben, sie zu erzählen und sich Sorgen darüber zu machen, ob es überhaupt noch Leser da draußen gibt. Das ist schade. Das ist, was ich versuche zu machen, auch wenn ich damit nicht sagen will, dass ich es genau richtig mache oder ein großer Erfolg darin bin, es anders zu machen. Aber ja, wenn ich auf dem Weg stolpere und falle, ich habe es wenigstens versucht.
Das Pamphlet soll also eine Kritik an diesem aktuellen Zustand sein?
Nicht unbedingt. Für mich ist es eher ein Aufschrei. Zuerst erkläre ich, dass der Leser nicht tot ist. Es liegt nicht daran, dass weniger Bücher verkauft werden, dass es weniger Bücher gibt, oder dass ein Interesse an Literatur fehlt. Es stimmt auch nicht, dass moderne technische Errungenschaften das Buch getötet haben. Das Buch wurde nicht vom Leser durch etwas anderes ersetzt. Es gibt auch nicht weniger Geschichten, die erzählt werden müssen, oder die es wert sind gehört zu werden. Dann erkläre ich, warum wir glauben, dass der Leser tot ist. Ich gehe auf die Entwicklung an den Schulen ein und versuche, die Autoren wachzurütteln. Ich glaube wirklich, wenn du Kunst machen willst, dann musst du rücksichtslos sein. Kunst nimmt alles in Anspruch. Sie kümmert sich nicht um die alltäglichen Probleme. Sie nimmt keine Rücksicht darauf, wie spät es ist. Sie will einfach „gemacht“ werden. Du musst mit ihr arbeiten. Im Moment sehe ich viele Zirkusclowns, die aussehen wie Autoren, die wie Autoren reden, die Bücher verkaufen, aber sie sind keine Autoren mehr. Sie sind Verkäufer. Das Buch ist ihre Ware. Das ist nicht mein Ansatz. Ich finde es schlimm, dass das das einzige ist, was da noch draußen ist. Ich kann nicht verstehen, warum Autoren nicht einfach ihr verdammtes Buch schreiben und sich nicht darum kümmern, was andere sagen, oder ob das Thema gerade gefragt ist. Aber so ist es nicht. Sie müssen sich überall zeigen, jeden kennen. Das Pamphlet soll also vielmehr eine Warnung sein. Es soll nicht heißen, dass ich alles weiß und sagen will, wie es richtig geht. Ich möchte damit eher Anregung geben, sich über den aktuellen Zustand Gedanken zu machen. Ich gebe einfach meine kritische Sicht auf den Stand der Dinge wider, beschreibe Entwicklungen und Tendenzen und verurteile niemanden. Ich hoffe, wenn man das Buch in zehn Jahren wieder liest, haben sich die Dinge geändert.
Nachdem wir unseren Kaffee ausgetrunken haben, werfen wir noch einen letzten Blick nach draußen und machen uns auf den Weg nach unten. Als wir aus dem Aufzug im Eingangsbereich der Bibliothek steigen, läuft in einem kleinen Fernseher gerade Werbung. Darin die James-Bond-Melodie. Ich muss schmunzeln.
***

Die OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam)
Auf 30.000 Quadratmeter stehen hier 1,7 Millionen Bücher. Rund 3,5 Millionen Besucher zählt die Bibliothek jährlich.
Im Foyer steht (wie an vielen Bahnhöfen hier) ein Klavier, auf dem jederzeit gespielt werden kann. Im 7. Stock befindet sich ein Café mit Dachterrasse, von der aus man einen wunderbaren Blick über die Stadt hat.
Quelle: 111 Orte in Amsterdam, die man gesehen haben muss von Thomas Fuchs (emos Verlag) Dieser besondere Reiseführer wurde uns netterweise vom Verlag für unsere Zeit hier in Amsterdam zur Verfügung gestellt.